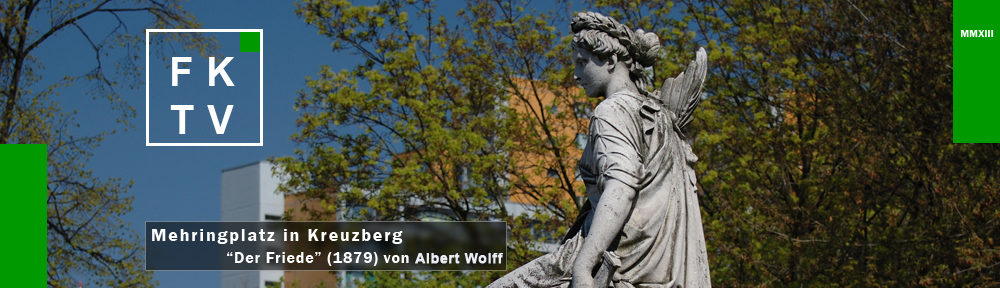Das ehemalige Stralauer Viertel am Ost Bahnhof.
Das ehemalige Stralauer Viertel am Ost Bahnhof.
„Unwillkürlich klappte er den Mantelkragen hoch, als er am Schlesischen Bahnhof aus der Stadtbahn stieg. Er hoffte, dass man ihm den Bullen nicht gleich ansah. Eine Polizeimarke war hier keine gute Empfehlung. Seine Mauser trug er heute geladen im Schulterpolster unter dem Jackett. Ihr Gewicht beruhigte ihn. In dieser Gegend wusste man nie was passierte.
Genau das machte den Reiz für viele Nachtschwärmer aus: Eine Nacht im Stralauer Viertel, neben mehr oder weniger verwegenen Verbrechern und schönen Frauen an der Bar zu sitzen, ihnen vom Nebentisch verstohlene Blicke zuwerfen – das war spannender als im mondänen Westen unterwegs zu sein.“
(aus „Der nasse Fisch – Gereon Raths erster Fall“ von Volker Kutscher, Copyright 2008, 2007 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln)

Wenn man sich die Gegend zwischen dem Ostbahnhof und der Karl Marx Allee in Friedrichshain heute anguckt, mag man gar nicht glauben, was sich dort vor 90 Jahren abgespielt hat, das damals so genannte „Stralauer Viertel“ war eine komplett andere Welt. Sicher, das dritte Reich, die Folgen des zweiten Weltkriegs und der darauf folgende massive Abriss zu DDR Zeiten haben das Gesicht dieser Gegend unwiderruflich verändert, aber auch die „Seele“ des Kiezes ist heute eine völlig andere.
Wo heute eine zugegeben doch ziemliche Ödnis aus vereinzelten Plattenbauten, breiten Straßen und Bürogebäuden sich auftut, herrschte vor dem zweiten Weltkrieg und vor allem vor 1933 Enge, Gefahr und Amüsement. Der Kiez war eine Mischung aus „Armeleuteviertel“, Tingeltangel und hartem Gangstertum, einer anderen Weltmetropole dieser Ära nicht unähnlich. Wo in New York Al Capone und ähnliche klangvolle Mafianamen herrschten, hielt man in Deutschland am bewährten Vereinswesen fest, hier hießen diese Gangsterbanden „Ringvereine“. Diese Vereine verteilten sich über die ganze Stadt, aber in dieser Gegend konzentrierten sie sich besonders, denn hier blühte alles, was ihr Nährboden war. Drogenhandel, Alkoholpanscherei, Prostitution, Hehlerei und Showbusiness.
Davon ist sehr wenig übriggeblieben. In den wenigen Altbauten, die es in diesem Kiez noch gibt finden sich an manchen Wohnungstüren ganze Ansammlungen an Türschlössern, die die in dieser vielfachen Ausfertigung dazu dienen sollten, die Gefahr vor der Tür zu lassen. Ein letzter Gruß aus dieser Zeit.
Wer oder was waren diese Ringvereine? Sehr lange wurde dieses Thema kaum beachtet, erst in letzter Zeit sind sie plötzlich wieder im Fokus, sicher auch ausgelöst durch die eingangs zitierten „Kommissar Rath“ Romane und deren Verfilmung unter dem Namen „Babylon Berlin“.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/zeitgeschichte-die-schlacht-am-schlesischen-bahnhof/1405284.html
Um 1890 wurden die ersten dieser Ringvereine gegründet, in erster Linie um ehemaligen Gefängnisinsassen nach deren Entlassung unter die Arme zu greifen. Schnell nahmen diese Organisationen nach dem ersten Weltkrieg Mafia ähnliche Strukturen an, wobei hier auch wieder die klassische Verankerung des Vereinswesens in der deutschen Gesellschaft deutlich wird. Sogar in der Verbrecherwelt ist man „im Verein“ organisiert. Die Bekanntesten waren „Immertreu“ „Apachenblut“, oder auch der „Sparverein“. Allerdings blieben die Ringvereine mit ihrer Gewalt fast ausschließlich unter sich, Außenstehende waren kaum betroffen. Wenn aber zwei verfeindete Vereine aufeinander trafen, flogen im wahrsten Sinne die Fetzen, in einer bekanntgewordene Beschreibung dieser Ereignisse waren es in erster Linie Schnapsflaschen und Räucheraale. Während also in einer Kneipe Leckereien geschändet wurden, schmissen zwei Häuser weiter Tänzerinnen ihre Beine hoch und schräg gegenüber wurden in einem Vorstadttheater Goethe und Schiller dargeboten und das Publikum lachte dazu. Der Schriftsteller Wilhelm Meyer Förster, Verfasser von u.a. „Alt Heidelberg“ und Freund von Erich Mühsam erinnerte sich an das Größte dieser Art, das Rose Theater in der Frankfurter Alle, Ecke Koppenstraße:
„Man sah dort ‚Maria Stuart‘, ging in der langwährenden Pause in den Garten, wo man Karussell fuhr, sah wieder einen Akt ‚Maria Stuart‘, ging wieder in den Garten, um nach der Scheibe zu schießen, sah endlich Mortimer sterben und aß dann im Garten sein Abendbrot.“
Man kann davon ausgehen, dass während Mortimers heiß erwartetem Ableben, in der Nachbarschaft diverse reale Opfer zu beklagen waren. Die vielfältigen Waffen saßen locker. Die große Kunst blühte allerdings woanders, in Mitte bei Max Reinhard, Erwin Piscator oder Bertold Brecht zum Beispiel. In Friedrichshain regierte der Tingeltangel.
Wie kam das, dass sich ausgerechnet hier diese Mischung ansammelte und sich so ausbreiten konnte? In anderen Arbeitervierteln wie im Wedding oder Neukölln waren diese Ringvereine auch sehr aktiv, aber dort fehlte aber das nächtliche Amüsement, wenn man mal von den Eckkneipen absah. In Kreuzberg gab es schon ein ausgeprägtes Nachtleben, aber der Kiez war zu dieser Zeit bürgerlicher, als man heute annimmt, damals am ehesten mit dem Prenzlauer Berg oder Schöneberg zu vergleichen. Die richtig „knallharten Kieze“ waren der Wedding, Neukölln und eben Friedrichshain. Ein wichtiger Faktor, der Friedrichshain von den beiden anderen unterschied, war natürlich der „große Bahnhof“, oder „Schlesischer Bahnhof“, wie er damals hieß und dessen Überreste heute den Namen „Ostbahnhof“ tragen. Damals, wie andere Bahnhofsviertel großer Städte auch ein Transitort, wo naturgemäß immer viel Bewegung herrschte, unabhängig davon, ob man dort lebte oder nur „im Transit“ war.
In dieser Flüchtigkeit konnte einiges gedeihen, wenn man erfolgreich war, gab es schnelles Geld und auch schnelles Vergnügen. Bordelle und dem Rotlichtmilieu angehörende „intime Nachtclubs“ gab es zuhauf.
Das „kulturelle Herzstück“ dieses Kiezes befand sich an der Stelle des heutigen Franz-Mehring-Platz, der damals „Küstriner Platz“ hieß. Wo heute große eine Leere herrscht, die manchmal durch die Farbtupfer einer Straßenbaustelle oder eines Linienbusses unterbrochen wird, befand sich damals DER Hotspot des Nachtlebens im Osten, das größte Varieté Theater Berlins, das „Plaza“, auch „Volks Varieté“ genannt, oder gar „Theater der 3000“, denn so viele Besucher passten dort hinein. Mehr Zuschauerplätze hatten noch nicht mal der Wintergarten und die Scala, die berühmtesten Varietés Berlins. So war es auch eine Gruppe um den große Impresario Jules Marx, u.a. Betreiber der Scala (In der heutigen Martin Luther Str. in Schöneberg), die 1929 das Plaza Theater eröffneten. In die Bahnsteighalle des 1867 erbauten ehemaligen Ostbahnhofes am Küstriner Platz (nicht mit dem heutigen Ostbahnhof, ein paar Meter weiter zu verwechseln) wurde ein Theatersaal „eingefügt“, dazu wurde ein neuer Bühnenturm gebaut. Allerdings hatten sie sich hier etwas verhoben. Der Gründe waren nicht nur die übliche Startschwierigkeiten, sondern vor allem das Aufkommen des Nationalsozialismus, das den jüdischen Betreibern das Leben erschwerte.
Trotzdem durfte dieses Leben noch ein paar Jahre weitergehen, allen Widerständen zum Trotz. Die Scala machte sich, das Publikum kam schließlich doch und amüsierte sich „wie Bolle“. Allerdings nicht alle.
„Inzwischen war das Licht ausgegangen. Ein Zauberer, der aussah wie ein Medizinmann trat als Erstes auf, dann Lasso-Akrobaten in Cowboykostümen, ein Messerwerfer mit Indianerschmuck. Als dann auch noch ein Cowboy sein Klagelied von der Einsamkeit der Prärie anstimmte, hätte Rath gerne mit Tomaten geworden.“(aus „Der nasse Fisch – Gereon Raths erster Fall“ von Volker Kutscher, Copyright 2008, 2007 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln)
https://de.wikipedia.org/wiki/Plaza_(Berlin)
Nicht nur aus der näheren Umgebung kam das Publikum, sondern auch aus den gediegeneren Stadtteilen, hier war das Amüsement doch etwas ganz Besonderes, etwas „Gefährliches“ schwang hier immer mit, zudem man danach noch in den umliegenden Bars „weiterfeiern“ konnte.
Aber auch diesem bunten Leben wurde mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 ein Ende gesetzt. Nicht nur die Betreiber des Plaza und andere Kulturschaffende im Kiez, auch den Ringvereinen ging es an den Kragen. Einige ließen sich mit den neuen Machthabern ein und wurden z.B. in die SA integriert. Viele aber ereilte ein anderes Schicksal. Ähnlich wie viele Protagonisten des Geistes- und Kulturlebens verhielt es sich mit vielen Ringvereinlern so, dass die prägenden Personen entweder fliehen mussten oder im Konzentrationslager landeten, so auch der prominenteste Ringvereinler Adolf Leib, „Muskel –Adolf“ genannt.
Auch sonst blieb nicht viel übrig von dieser Welt, das Plaza Varietetheater zum Beispiel wurde von der NS Organisation „Kraft durch Freude“ übernommen und dementsprechend war dann auch das Niveau, bis das Gebäude 1944 endgültig zerbombt wurde. Dem Rose Theater ging es ähnlich, parallel dazu verblühte die Nachtclubszene. Dann kam der zweite Weltkrieg, schließlich der kalte Krieg und heute knallt dort gar nichts mehr.