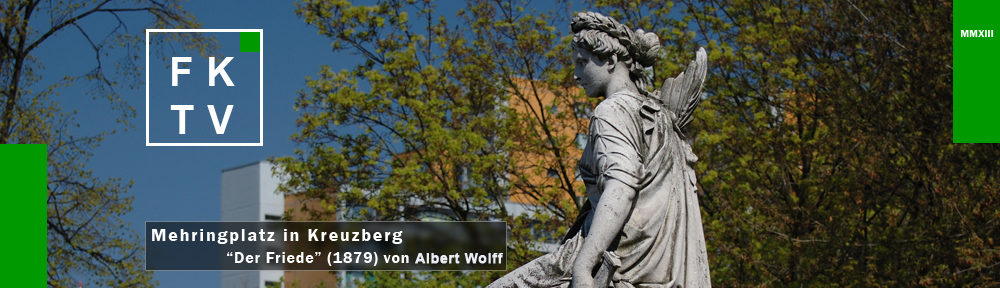Das Stellwerk mit Neo-Renaissance-Dach ist eines der noch erhaltenen Gebäude aus dem Eröffnungsjahr 1902
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts machte das Wachstum der Berliner Bevölkerung Schritte notwendig, um einen Kollaps im Verkehrs- und im Gesundheitswesen abzuwenden. James Hobrecht und Kollegen gliederten die neuen und alten Stadtviertel um und bis 1893 wurde eine erste Kanalisation gebaut. Die neue Arbeitskultur des industrialisierten Kapitalismus machte darüber hinaus auch ein innerstädtisches Transportsystem notwendig, das eine ausreichende Zahl Arbeiter von den Mietskasernenvierteln zu den großen Fabrikstandorten bringen konnte.
Der Hochbahnhof Warschauer Straße mit Stellwerk und Wagenreparaturhalle – Ansicht von der Warschauer Straße
Werner Siemens regte spätestens ab 1880 den Bau einer elektrischen Bahnlinie in Berlin an, um dem zunehmenden Verkehr der stetig wachsenden Reichshauptstadt zu begegnen. Vermutlich sah man den Bau auch als weitere Teststrecke für die Entwicklung und Vermarktung elektrisch betriebener Personenbeförderung in städtischen Räumen, denn das von Siemens & Halske bereits 1896 in Budapest eröffnete System einer Unterpflasterbahn konnte in Berlin und anderen Städten nicht umgesetzt werden. Die Elektrifizierung der bereits vorhandenen Linien der Berliner S-Bahn war ebenfalls noch vor der Jahrhundertwende geplant worden, wurde aber erst 1903 begonnen und 1924 abgeschlossen. So ist die Berliner Hoch- und Untergrundbahn von 1902 die erste rein elektrische Bahnstrecke der Stadt und die erste von anderen Verkehrsführungen unabhängige Stadtbahntrasse mit hoher Transportkapazität im deutschsprachigen Raum.
Geplant wurde der Bau wohl bereits ab 1891. Vorbehalte gegen die Tragfähigkeit des Berliner Untergrunds konnten unter anderem durch den Bau des Stralauer Spreetunnels zerstreut werden, dennoch entschied sich die Stadtverwaltung zunächst für ein Hochbahnsystem und damit unter anderem gegen U-Bahn-Pläne der AEG, vielleicht aus Sorge um die frisch gebaute Kanalisation, vielleicht auch aus Kostengründen. Am 18. Februar 1902 wurde schließlich die erste Strecke Stralauer Tor – Potsdamer Platz als kombinierte Hoch- und Untergrundbahn eröffnet, nachdem die Strecke mit der „Ministerfahrt“ am 15. Februar freigegeben worden war. Sie wurde von der 1897 gegründeten Hochbahngesellschaft gebaut und betrieben, einer Tochtergesellschaft der Firmen Siemens & Halske und Deutsche Bank. Das Teilstück Stralauer Tor – Potsdamer Platz folgte dem Verlauf der seit 1870 abgerissenen Zollmauer. Der Abschnitt Potsdamer Platz – Zoologischer Garten war ebenfalls bereits mit der Ministerfahrt freigegeben worden und begann am 11. März 1902 den öffentlichen Linienverkehr.
Die Planung und Fertigstellung der Strecke unterlag Siemens & Halske. Es ist anzunehmen, dass das Teilstück Oberbaumbrücke – Stralauer Tor – Warschauer Straße zunächst als Ensemble geplant war, dennoch unterscheiden sich die ausgeführten Baustile deutlich voneinander. Nach der Fertigstellung der von Otto Stahn geplanten, betont repräsentativen neogotischen Oberbaumbrücke 1896 entstanden die funktionaleren Hochbahnhöfe Stralauer Tor und Warschauer Straße in den Jahren 1898-1902 nach Plänen von Paul Wittig. Dessen heute noch erhaltenes Treppenhaus am Warschauer Platz greift, exemplarisch für Wittigs Bahnhofsgebäude, in seinen Schmuckelementen die deutsche Renaissance auf.
Auch die heute noch bestehenden Wagenreparaturhallen an der Warschauer Straße entstanden schon 1902 als erste Werkstätten der Berliner Hoch- und Untergrundbahn. Alfred Grenander war ab 1900 künstlerischer Bauleiter bei der Hochbahngesellschaft und später maßgeblicher Architekt zahlreicher U-Bahnhöfe. Auf dem Gelände des Hochbahnhofs Warschauer Straße entwarf er die 1907 fertiggestellte doppelgeschossige Wagenhalle an der Ehrenbergstraße und Rudolfstraße in moderner Stahlskelettbauweise.
Der U-Bahnhof Stralauer Tor, mit Zugang über eine Verkehrsinsel auf der Mühlenstraße, lag direkt an der Nordostecke der Oberbaumbrücke und nur wenige Meter vom Hochbahnhof Warschauer Straße entfernt. Dennoch wurde dieser nach seiner Fertigstellung im August 1902 zum neuen Endbahnhof der Strecke, wobei auch der Bahnhof Stralauer Tor weiterhin bedient wurde. Über den S-Bahnhof Warschauer Straße ergab sich ein Anschluss der neuen Strecke an den damaligen Nordring der S-Bahn, der zwischen West- und Ostkreuz über die Stadtbahn verbunden war, auch wenn ein Gleisanschluss nie realisiert wurde.
Der Bahnhof Stralauer Tor wurde 1924 in Bahnhof Osthafen umbenannt und im März 1945 so schwer zerstört, dass er auch nach der erneuten Inbetriebnahme der Linie ab Oktober desselben Jahres nicht wieder aufgebaut wurde. Die Schreibweise Stralauer Thor war bereits seit der Orthographischen Konferenz von 1901 obsolet.
Auch der Treppenturm am Warschauer Platz zeigt Einflüsse der Neo-Renaissance
Die Wagenreparaturhalle Ehrenbergstraße / Rudolfstraße wurde nach Plänen von Alfred Grenander gebaut
Historische Ansicht der Oberbaumbrücke und des Bahnhofs Stralauer Tor. Foto von Max Missmann aus dem Jahr 1924. Foto gemeinfrei. Quelle: Wikimedia.
Fotos und Text: Sebastian Wehr, mit Infos aus denkmaldatenbank.berlin und wikipedia.org | https://denkmaldatenbank.berlin.de/daobj.php?obj_dok_nr=09095053