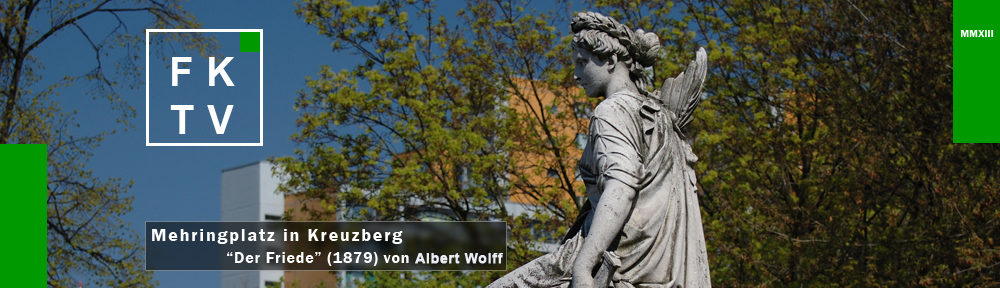Nach einer Begegnung des Künstlers Gunter Demnig in Köln mit einer Zeitzeugin der Deportationen zur Zeit des NS-Regimes wuchs in ihm die Idee, an die Deportierten zu erinnern, indem jeweils ein Pflasterstein symbolisch für die Rückkehr dieser Menschen in ihr angestammtes Wohnumfeld verlegt werden soll.
Am 16. Dezember 1940 gab Himmler den Befehl zum Abtransport der Sinti und Roma in die Vernichtungslager. Die Zeitzeugin aus Köln konnte sich einfach nicht daran erinnern, dass es je Sinti und Roma in ihrer Nachbarschaft gegeben hatte. Das Kunstprojekt Stolpersteine wehrt sich gegen das Vergessen und lässt Menschen über jenen Teil der deutschen Geschichte stolpern.
1995 verlegte Demnig die ersten 250 Steine in die Gehwege der Stadt Köln. Diese zehn mal zehn Zentimeter großen und einseitig mit einer goldfarbenen Messingplatte bedeckten Kunstwerke wurden zuvor auf Initiative des Pfarrers der Kölner Antoniter Gemeinde, Kurt Pick, in seiner Kirche ausgestellt.
In die Messingplättchen sind Name, Geburtsdatum, Deportationsdatum und – soweit bekannt – auch das Todesdatum sowie vereinzelt die Todesursache eingraviert.
Der am 27. Oktober 1947 in Berlin geborene und zum Großteil in Kreuzberg aufgewachsene Demnig genoss vielfältige Ausbildungen im Bereich der Kunst, der Kunstpädagogik und im Design sowie besitzt er auch jahrelange Erfahrungen im künstlerisch-wissenschaftlichen Bereich.
Neben unzähligen anerkannten Werken, Ausstellungen und Auszeichnungen können die Stolpersteine als sein wichtigstes und auch aufsehenerregendstes Werk angesehen werden.
Die Berliner Stolperstein-Initiative, die ihrerseits in lokale Stadtteilinitiativen gegliedert ist, stellt die zentrale Plattform zur Initiierung eines neuen Stolpersteins dar. Angehörige oder alte Freunde aber auch historisch Interessierte können unter Berufung auf entsprechende Rechercheergebnisse Personen für Stolpersteine vorschlagen. Wichtig seien dabei das Geburtsjahr, die Eckdaten der Biografie vor der Deportation und auch die Eckdaten zu den Deportationswegen, eine zentrale Rolle spielen natürlich auch der letzte frei gewählte Wohnort in Berlin und das Sterbedatum. Für eine zuverlässige Recherche hat der Verein auf seiner Internetpräsenz einen Leitfaden mit umfangreicher Linksammlung zur Verfügung gestellt.
www.stolpersteine-berlin.de
Größtenteils war und ist es so, dass die Initiatoren der Stolpersteine selbst für das Mahnmal und dessen Herstellung aufkommen mussten bzw. müssen. Geschätzt war/ ist ein Gesamtbetrag von ca. 130 bis 160 Euro pro Stein vonnöten. Als bis dato erster und einziger Bezirk in Berlin übernimmt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg seit November 2017 nun diese Kosten. Mit dem Argument, dass „Angehörige und Nachfahren der Opfer des NS-Regimes nicht auch noch für deren Gedenken aufkommen müssen“, erklärt Clara Herrman, Bezirksstadträtin für Finanzen, Umwelt, Kultur und Weiterbildung, diesen Schritt.
Einen guten Überblick über die vielfachen „Gründe“ aufgrund derer Menschen vom NS-Regime gejagt wurden, gibt die Ausstellung der Berliner Stolperstein-Initiative. Die Wanderausstellung ist gegenwärtig in der Villa Oppenheim in Berlin-Charlottenburg zu sehen. Neben Menschen jüdischen Glaubens wurden auch sehr viele andere menschliche Lebensstile gebrandmarkt und verfolgt, subsumiert unter dem Begriff „Asoziale“. Homosexuelle, Obdachlose, Zeugen Jehovas, politisch und religiös motivierte Widerständler, Sinti und Roma, behinderte Menschen – für all diese Menschen sind die Stolpersteine gedacht.
Ein weiterer wesentlicher Teil der Arbeit dieser Initiative ist die Betreuung von pädagogischen Projekten. Gerichtet an Schüler ab zwölf Jahren werden diese über den gesamten Prozess von der Initiierung bis hin zur Verlegung der Steine geführt und betreut. Hierbei geht es natürlich einerseits um die Würdigung eines Menschen in Form intensiver Biographiearbeit, andererseits aber auch um das Einordnen und Verstehen eines breiteren historischen Kontexts, in dem dieses furchtbare Phänomen entstehen konnte.
Kurz nach Verlegung der ersten Steine in Köln kam es auch in Berlin zu einer Kunstaktion, in der die ersten Berliner Steine – 51 Stück – im Gebiet der Dresdner Straße und der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg verlegt wurden; damals noch ohne Genehmigung. Diese folgte kurz darauf nachträglich und ab dem Jahre 2000 gab es unzählige Verlegungen, die dann selbstredend legal waren und es ermöglichten, dass das größte dezentrale Mahnmal der Welt entstehen konnte. In Friedrichshain-Kreuzberg kann man mittlerweile 846 Stolpersteine finden, berlinweit sind es 7.420 Steine, deutschlandweit über 45.000 und über Europa verteilt fast 60.000; eine Topographie des Terrors in kontinentalem Ausmaß sozusagen.
Im Mai 1996 wurde der erste Stein in Berlin in der Oranienstraße 157 in Kreuzberg verlegt. Lina Friedemann wurde geehrt. Sie zog 1891 nach Berlin und absolvierte hier eine Lehre als Wirtschafterin. Verheiratet war sie nie, zog aber ihren Neffen Erich groß und lebte die meiste Zeit zusammen mit ihren Geschwistern in einer Wohnung. Ab 1935 wohnte sie zusammen mit dem Bruder Willy und den Schwestern Sophie und Ella in der Oranienstraße 157. Am 15. August 1942 wurden Lina und Willy nach Riga deportiert und sofort ermordet.
So wie Lina und Willy Friedemann erging es in nicht nachvollziehbarem Ausmaß vielen Menschen. Dabei schützten weder Bekanntheitsgrad noch einflussreiche Freundschaften.
So zum Beispiel Erich Knauf, 1895 geboren, der über diverse Stationen im journalistischen Bereich ab 1936 Pressechef der Filmgesellschaft „Terra Film“ wurde und hier hauptsächlich Produktionen mit Heinz Rühmann betreute, zudem schrieb er einige Schlager, u. a. auch „Der Frühling liebt das Flötenspiel“ aus der Feuerzangenbowle. Auf Grund fadenscheiniger Denunziationen wurde Knauf am 28. März 1944 verhaftet und am 6. April hingerichtet. Selbst die persönliche Vorsprache Heinz Rühmanns bei Goebbels konnte an der Verurteilung nichts ändern.
Am 15. Oktober 2014 wurde in der Dudenstraße 10 ein Stolperstein für Erich Knauf verlegt.
Oder der deutsche Meister im Halbschwergewicht aus dem Jahre 1933 Johann Wilhelm „Rukeli“ Trollmann, ein Sinto. Jener Meisterschaftskampf sollte eigentlich gar nicht anerkannt werden, das wütende Publikum jedoch bestand auf einer angemessenen Ehrung des Siegers bzw. überhaupt erst auf dessen Ernennung. Im Juli desselben Jahres wurde ein neuer Kampf angesetzt, der für Trollmann nicht zu gewinnen war. Unter Androhung des Entzugs seiner Boxlizenz musste er sich an Auflagen halten, die ihn in seinem Kampfstil massiv einschränkten. Dieser erinnerte an das Tänzelnde eines Muhammed Ali und das dadurch mögliche Ausweichen der Schläge sowie höchstmögliche Flexibilität. Dieser Boxstil war nicht arisch, Trollmann sollte aber gefälligst arisch kämpfen. So erschien er mit blondgefärbten Haaren und einer weiß gepuderten Haut und blieb fest verwurzelt auf dem Boden stehen. Er verlor. Zu der durch die Nazis zerstörten Boxkarriere kamen 1935 die Zwangssterilisierung, die Einberufung in den Krieg an der Ostfront und schließlich 1942 die Verschleppung ins KZ. Dort musste er „Boxkämpfe“ gegen die Aufseher bestreiten; als er bei einem Kampf einen Kapo K.O. schlug, nahm sich dieser einen Holzknüppel und erschlug Trollmann. Das war am 9. Februar 1944.
Für Johann „Rukeli“ Trollmann wurde am 01.07.2010 ein Stolperstein in der Fidicinstraße 1-2 verlegt.
Das Kunstprojekt Stolpersteine stellt sowohl in künstlerisch-ästhetischer Hinsicht als auch in Erinnerungskultur betreffender Hinsicht eine Besonderheit dar. Einerseits handelt es sich hier um doch recht kleine Mahnmale, unter Umständen sogar manchmal übersehbar, andererseits ergeben all die tausend kleinen Mahnmale ein Gesamtwerk, das sich über 21 europäische Länder erstreckt.
Und auch die Tatsache, dass jene Stolpersteine für alle vom NS-Regime Deportierten stehen, zeugt von einer neuen Erinnerungskultur.
Fotos & Text: Christian Eitz