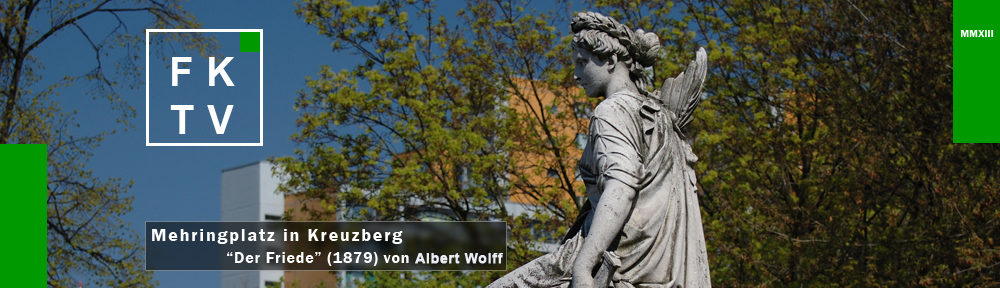Als Zentrum der historischen Luisenstadt gilt der Oranienplatz.
Im Zuge der Neugestaltung des bis dato von hugenottischen Einwanderern und Handwerkern besiedelten Viertels begann Peter Joseph Lenné ab 1841 die architektonische Restrukturierung. Der Oranienplatz, an dem drei große Verkehrsadern zusammenstießen – die Oranienstraße, die Dresdner Straße und der Wasserweg des Luisenstädtischen Kanals – sollte als zentraler Knotenpunkt etabliert werden. Bis 1852 dauerte die Umgestaltung des Platzes, der aufgrund seiner Zweiteilung wegen des Kanals durch die Oranienbrücke „zusammengehalten“ wurde.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überquerten Straßenbahnen und Kutschen den Platz. Hier begannen die Überlandfahrten Richtung Südosten, zum Beispiel nach Sachsen und andersrum stiegen Reisende aus dem Umland von den Kutschen in die Bahnen um. Die Oranienstraße war bis Mitte des 19. Jahrhunderts die südöstliche Stadtgrenze.
Auch der Bau einer U-Bahnstation wurde begonnen, jedoch aufgrund des 1. Weltkriegs zum Stillstand gebracht. 1921 kam es zur Fertigstellung des Baus, benutzt wurde die Station aber nie, da sich die Stadt 1927 entschied, die Strecke der U8 über den Moritzplatz zu führen. Nach Jahren verschiedenster Alternativnutzungen schüttete man den Rohbau jener „U-Bahnstation“ zu.
Der Versuch, den Oranienplatz in den 1960er bis 1980er Jahren zu einem Autobahnkreuz umzufunktionieren, konnte nie umgesetzt werden, da hier eine seit langer Zeit bestehende Milieustruktur zu sehr zerrissen worden wäre. Umgestaltungen an diesem Platz gab es viele, nicht zuletzt auch die Zuschüttung des Kanals und die sich daran anschließende gärtnerische Aufwertung entlang des ehemaligen Verlaufs zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die letzte Umgestaltung passierte 2007. In Anlehnung an die ursprünglichen Entwürfe sollte die damalige Atmosphäre dieses Ortes wieder erlebbar gemacht werden.
Seit 1990 gilt er als denkmalgeschützt, genauer als „Gartendenkmal“.
Einige der heutigen Häuser am Platz haben die zwei Weltkriege überstanden. Sie sind natürlich denkmalgeschützt, können aber – obwohl alternativ genutzt – besucht werden.
Am 07. Juni 1860 erhielt der Apotheker Rudolph Ernst Emil Kade die Konzession für eine Apotheke und zog zeitgleich in das Haus Nummer 15 ein. Der Apotheke angegliedert war das pharmazeutische „Fabrications und Exportgeschäft“, welches Ende des 19. Jahrhunderts zum „Hoflieferanten des Kaisers und Königs“ wurde und vorrangig die deutschen Überseegebiete und die kaiserlichen Schutztruppen belieferte. Die Oranien-Apotheke konnte sich tatsächlich bis in das Jahr 2015 behaupten und war somit eine der ältesten Apotheken Berlins. Heute befindet sich hier ein kleines Café, in dem das beeindruckende ursprüngliche Mobiliar, so weit möglich, in die neue Nutzung einbezogen wurde.
Auch interessant ist die Geschichte des „Kuchenkaisers“. 1865 wurde ein viergeschossiges Haus errichtet, das eine imposante Konditorei beherbergte. Hier lebten und arbeiteten bis zu 100 Angestellte zusammen mit der Familie. Meisterwerke der Backkunst wie „Kaisers Elfentorte“, „MokkaParfaits“ oder „PrinzessBaumkuchen“ waren sehr beliebt und wurden sogar bis nach New York versandt. Dafür wurde sogar ein eigener privater Versandhandel eingerichtet. Leider musste der Betrieb trotz überstandenen Krieges im Jahre 1957 eingestellt werden. Geblieben ist jedoch der Name und ein kleines Café erinnert heute an die süße Zeit.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam ein fünfstöckiges Warenhaus zum baulichen Ensemble hinzu. Ursprünglich als Warenhaus Brenninkmeyer gestartet, ist dieses Haus heute ein im politisch aktiven Kreuzberg 36 nicht ganz unumstrittenes Luxushotel. Prominentester Besitzer war in den 1930er Jahren wohl die holländische Textilfirma „Allgemeine Textil-Fabrikations und Handels AG Clemens & August Brenninkmeyer“, welche sich im Laufe der Zeit wegen des sperrigen Namens in „C&A“ umbenannte.
Insgesamt finden sich heute am Oranienplatz mehrere Häuser, die als Baudenkmäler gelistet sind. Die meisten von ihnen erbaut um die Jahrhundertwende.
Von der Errichtung bis heute gab es vielfältige Varianten der Nutzung dieses Ortes. Als ursprünglicher Verkehrsknotenpunkt und Zentrum der alten Luisenstadt konzipiert, wandelten sich der Platz bzw. der Platz und seine Umgebung in den 60er und 70er Jahren zu einem Ort, der für Leerstand und Spekulation stand, da der Ausbau des geplanten Autobahnkreuzes ausblieb. Der Leerstand zog dann im Laufe der Zeit die Hausbesetzerszene an, die „autonome Republik Kreuzberg“ wurde ausgerufen. In den 80er Jahren war der Oranienplatz der Startpunkt der „Revolutionären 1. Mai Demo“. Nicht selten wurde der Platz zum Schauspiel schwerer politischer Auseinandersetzungen. Eine der Gründerinnen der Hausbesetzerszene rief dann Anfang 2000 das „MyFest“ ins Leben. Von nun an sollte der Oranienplatz wieder ein Ort der Begegnung und des Findens von Gemeinsamkeiten unter den Menschen sein. Das „MyFest“ ist eine feste Größe unter den Berliner Open-Air Veranstaltungen.
Eine weitere politische Nutzung des Platzes ergab sich durch die zunächst provisorische Einrichtung eines Flüchtlingscamps in der Zeit von 2012 bis 2014. Ein Marsch, beginnend in Würzburg und endend in Berlin, sollte auf verschiedene Belange der Geflüchteten aufmerksam machen. Nach einiger Zeit des Tauziehens zwischen dem Bezirk und dem Senat wurde das Camp schlussendlich geräumt. Ein Recht zur Nutzung des Oranienplatzes für die Aufklärung jener für Geflüchtete relevanter Themen wurde aber explizit ausgesprochen.
Heute ist der Oranienplatz ein ruhiger und gut gepflegter Ort. Als Zentrum des Kiezes dürfte er schwerlich zu erkennen sein. Im Sommer ist er aber ein schöner Ort zum Verweilen, auf einer Bank unter schattenspendenden Platanen sitzend, den älteren Herren beim Boule-Spiel zuschauend.
Text & Fotos: Christian Eitz